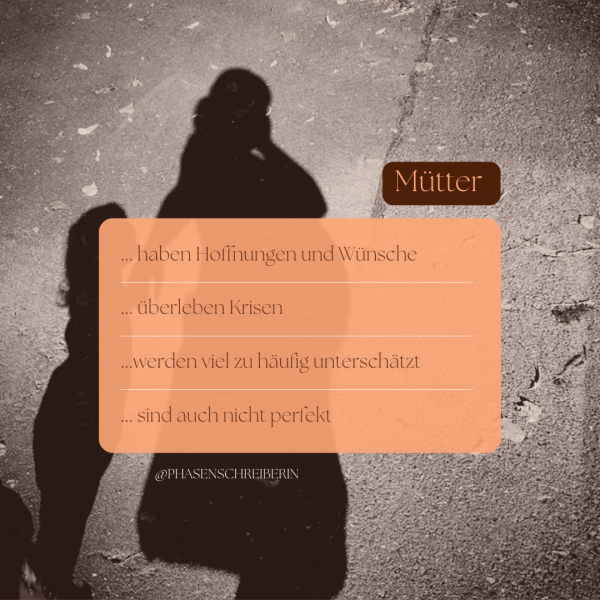Müttergenerationen – von Zwängen und Emanzipation
Kennt jemand von euch den Spruch: „Mach‘ keine Fisimatenten“? Es ist ganz witzig, dass wir hier im Rheinland sind, denn hier hat der Spruch angeblich seinen Ursprung. Wenn man den Rheinländern Glauben schenkt, stammt das Wort „Fisimatenten“ aus der französischen Besatzungszeit Anfang des 19. Jahrhunderts. Angeblich versuchten die Soldaten junge Mädchen in ihre Zelte zu locken, indem Sie Sätze sagten, wie „Visitez ma tente“. Gingen die Mädels abends also aus, riefen ihre Väter ihnen hinterher, sie sollten keine „Fisimatenten“ machen. Meine Oma machte Fisimatenten nach dem zweiten Weltkrieg. So ist meine Tante entstanden. Aber fangen wir früher an:
Mein Uropa war verwitwet und hatte bereits sieben Kinder als er meine Uroma traf, ebenfalls verwitwet, fünf Kinder. Das muss kurz nach dem ersten Weltkrieg gewesen sein. Übrigens das Jahrzehnt, in dem der erste „Internationale Tag der Frauen“ stattfand. Die beiden heirateten, damit irgendwer seine Rente bekommt, wenn er stirbt. Dumm nur, dass die Inflation wenige Jahre später die Rententöpfe leerte und letztlich doch niemand mehr so richtig etwas davon hatte… Aber Moment… 7 Kinder hier, 5 Kinder da… Das sind 12! Kinder – nach dem ersten Weltkrieg. Als ich diesen Text schreibe, sitze ich auf meiner Couch, müde vom Alltag mit Job und gerade mal zwei Kindern.
Jedenfalls bekamen die beiden noch ein Kind, Nr. 13, Klara, meine Oma. Kind einer Zweckehe – verwöhntes Nesthäkchen und Sorgenkind. Mit sechs Jahren litt sie an einer schweren Augenkrankheit, weshalb sie monate- oder sogar jahrelang in einem dunklen Zimmer bleiben musste. Die Krankheit ließ sie nahezu erblinden, weshalb sie der Familie nicht im Haushalt helfen konnte. Beim Kochen vertauschte sie einmal die Ofenklappen und schmiss die Kartoffeln zu den Kohlen. Als einziges leibliches und jüngstes Kind beider Eltern und mit zwölf Halbgeschwistern war sie etwas Besonderes und wurde von der ganzen Familie verwöhnt. Später, als junges und unbeobachtetes Mädchen von vielleicht 17 Jahren verliebte Klara sich in Edgar – einen charmanten jungen Mann. Es muss Ende der 1930er gewesen sein. Sie wurde schwanger, er verschwand als Soldat in den Wirren des 2. Weltkriegs und kam nie zu ihr zurück. Klara bekam einen Jungen – Edgar. Vielleicht überfordert, aber ganz bestimmt unglücklich verliebt wollte sie nur noch eins, den Vater ihres Kindes eifersüchtig machen, sollte er doch noch auftauchen. Also traf sie sich mit weiteren jungen Männern, was ihren Geschwistern nicht verborgen blieb. Ihre Sehschwäche, ihre dadurch langsame und vorsichtige Art, die sie auf andere vielleicht dümmlich wirken ließ, ihr uneheliches Kind, ihre Umtriebigkeit, die ihrer Familie vielleicht peinlich war. Das alles nahmen ihre Geschwister zum Anlass, um einen Termin zur Zwangssterilisation zu erwirken. Keine Schwierigkeit in der NS-Zeit. Und übrigens auch heute noch unter bestimmten Umständen in 13 Ländern der EU erlaubt. Der Termin stand und sie waren schon auf dem Weg, aber Klara schaffte es irgendwie, diesem Schicksal zu entgehen. Es ist nicht überliefert, ob sie sich wehrte oder weinte, aber irgendwas brachte ihre Geschwister zur Vernunft und das Vorhaben wurde nicht umgesetzt.
Als der Krieg vorbei war und die Besatzungsmächte ihre Soldaten stationierten, lockten diese mit den eingangs genannten Fisimatenten. Auch Klara – und sie wurde wieder schwanger. Sie bekam eine wunderbare Tochter von einem schönen Franzosen mit Stupsnase. Als er zurück nach Frankreich durfte, wollte er Klara und die gemeinsame Tochter mitnehmen, aber er hatte keine Chance. Klara blieb in Deutschland, nun mit zwei Kindern, ohne deren Väter und weiterhin nicht in der Lage, in der Nachkriegszeit eine Familie zu versorgen. So kam ihre Tochter mit ca. zwei Jahren ins Kinderheim. Bis heute sind beide Väter nicht auffindbar.
Nach Ende des Krieges wurden die Karten neu gemischt. Millionen Menschen hatten ihre Heimat verloren. So auch Eugen. Ein Rumäne aus Bukowina, der viele Jahre in Arbeitslagern verbringen musste und nun – freiwillig oder unfreiwillig – in Deutschland blieb. Die deutsche Sprache brachte er sich selbst bei. Lange Zeit versuchte er, seine Mutter und seine Schwester zu finden. Vergeblich. Es ist unbekannt, ob sie überlebten oder ob sie auf der Flucht oder in einem Arbeitslager starben. Irgendwann traf Eugen auf Klara. Die beiden verliebten sich, oder zumindest reichte es für eine erneute Schwangerschaft und meine Urgroßeltern drängten zur Hochzeit. Eugen nahm Edgar als seinen Sohn an und holte Klaras Tochter aus dem Heim zurück. Es folgten noch zwei Söhne und Anfang der 50er eine Tochter – meine Mutter. Eugen war ein strenger Vater. Er verwaltete die Ressourcen der Familie: das Geld, zu dem nur er Zugang hatte und die Lebensmittel, denn nur er bereitete das Essen zu. Die Kinder mussten in der Zwei-Zimmer-Wohnung bleiben und brav und still nebeneinander auf der Couch sitzen. Benahmen sie sich nicht so, wie er es sich vorstellte, wurde er jähzornig, schrie und schlug auch mal zu.
Meine Mutter verbrachte immer mehr Zeit auf der Straße. Sobald ihr Vater nach Hause kam, lief sie weg. Sie nahm in Kauf, dass er ihretwegen täglich tobte. Als junges Mädchen arbeitete sie auf Kartoffelackern, bekam fünf Mark pro Tag, wovon sie vier ihrem Vater geben musste. Doch als sie älter wurde, nahm sie einen Job an, bei dem sie Daten mittels Lochkarten in Computer eingab, die ganze Räume füllten. Die 60er waren das Jahrzehnt der Wirtschaftswunder, Rezession, erneutem Aufschwung, Protesten und Aufstand der jungen. Die Tugenden Fleiß, Unterordnung und Gehorsam wurden abgelöst durch Freiheitsliebe und Mitbestimmungsdenken. Anfang der 70er ging dieser Trend weiter – deutsche Soldaten durften lange Haare tragen, berufstätige Frauen durften nicht mehr mit „Fräulein“ angesprochen werden… Die Debatten um diese Entscheidungen erinnern sehr an heutige Gender-Debatten.
Etwa zu dieser Zeit traf meine Mutter meinen Vater. Lange Haare, Schlaghose, Schnäuzer. Fernfahrer. Eigentlich stand ihre Freundin auf ihn und sie selbst war überhaupt nicht interessiert. Aber er ließ nicht locker und eroberte sie. Mama war ungefähr in dem Alter, in dem ihre Mutter sich in den Vater ihres ersten Kindes verliebte. Aber auch jetzt noch, fast 40 Jahre später, war die Volljährigkeit erst mit dem 21. Geburtstag erreicht. Das sollte sich erst 1975 ändern. Meine Mutter musste also – aller Freiheitsliebe zum Trotz – jeden Abend zurück zu ihrem unterdrückenden Vater. Ein Schlupfloch gab es jedoch: Sollte ihr Vater einer Hochzeit zustimmen, würde sich die Vormundschaft auf ihren Ehemann übertragen. Mein Opa stimmte zu, blieb aber hart. Nach der Verlobungsfeier musste meine Mutter abends wieder nach Hause, erst am Tag der Hochzeit setzte mein Vater sich durch und nahm sie endlich für immer mit in das nun gemeinsame Leben. Doch der Start in dieses Leben sollte holprig werden:
Hatte meine Mutter vor ihrer Ehe noch ein eigenes Konto, war dies nun automatisch auf ihren Ehemann und Vormund überschrieben worden. Plötzlich stand da sein Name. Trotz aller Kämpfe um Freiheit und Gleichberechtigung, parallel zu den Anfängen der neuen Frauenbewegung rund um Alice Schwarzer, hatte das Patriarchat voll zugeschlagen. Vielen Frauen hatten solche Aktionen die Existenzgrundlage und ein großes Stück Selbstwertgefühl genommen. Meine Eltern versuchten gleichberechtigt zu leben, aber spätestens im Haushalt waren die Rollen klar und klassisch verteilt. Als meine Mutter das erste Mal nach der Hochzeit Gulasch kochen sollte – während mein Vater im Wohnzimmer Zeitung las – ließ sie das Fleisch anbrennen und brach weinend in der Küche zusammen. Ihr eigener Vater hatte doch nie jemanden an den Ofen gelassen, woher hätte sie wissen sollen, wie man kocht? Aber das ist gar nicht das Traurige an der Geschichte. Traurig ist, dass sie sich nicht getraut hat, meinem Vater davon zu erzählen. Als er zwei Stunden später nachsehen wollte, wo das Essen bleibt und in die verrauchte Küche trat, fand er dort meine noch immer heulende Mutter. Er nahm sie in den Arm, fragte völlig unverständlich, warum sie ihm das nie gesagt hatte und kochte einfach selbst. In den nächsten Jahren lernte sie das Kochen übrigens von meinem anderen Opa, ihrem Schwiegervater.
Vier Jahre nach der Hochzeit bekamen meine Eltern ihr erstes Kind, meinen großen Bruder. Meine Mutter hörte auf zu arbeiten und mein Vater ließ auf ihren Wunsch die Fernfahrerei sein, um öfter zu Hause sein zu können. Weitere sechs Jahre später kam ich auf die Welt, Anfang der 80er. Ein völlig verrücktes Jahrzehnt, zu dem ich keinerlei Bezug habe. Ich erinnere mich, dass meine Mutter stundenweise als Putzhilfe arbeitete und erst als ich älter war in Teilzeit einen miesen Arbeiterinnenjob in einer Großwäscherei annahm, der sie später durch Mobbing in die Depression trieb. Mein Vater arbeitete rund um die Uhr und war kaum zu Hause.
Ich bin mit diesem ganz typischen Rollenbild von Mann und Frau großgeworden. Doch meine eigene Kindheit soll hier und jetzt kein Thema sein.
Dieser Text endet hier. Er ist nur ein kleiner Auszug aus drei Mütter-Generationen und ihren ganz eigenen Hindernissen und Schicksalen.
Wenn man den Rheinländern Glauben schenkt, stammt das Wort „Fisimatenten“ aus der französischen Besatzungszeit Anfang des 19. Jahrhunderts. Angeblich versuchten die Soldaten junge Mädchen in ihre Zelte zu locken, indem Sie Sätze sagten, wie „Visitez ma tente“. Gingen die Mädels abends also aus, riefen ihre Väter ihnen hinterher, sie sollten keine „Fisimatenten“ machen. Meine Oma machte solche Fisimatenten nach dem zweiten Weltkrieg. So ist meine Tante entstanden. Aber fangen wir früher an:
Mein Uropa war verwitwet und hatte bereits sieben Kinder als er meine Uroma traf, ebenfalls verwitwet, fünf Kinder. Das muss Ende der 1910er Jahren gewesen sein. Übrigens das Jahrzehnt, in dem der erste „Internationale Tag der Frauen“ stattfand. Die beiden heirateten, damit irgendwer seine Rente bekommt, wenn er stirbt. Dumm nur, dass die Inflation wenige Jahre später die Rententöpfe bis aufs Letzte auffraß und letztlich doch niemand mehr so richtig etwas davon hatte… Aber Moment… 7 Kinder hier, 5 Kinder da… Das sind 12! Kinder unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg. Als ich diesen Text schreibe, sitze ich auf meiner Couch, müde vom Alltag mit Job und gerade mal zwei Kindern.
Jedenfalls bekamen die beiden noch ein Kind, Nr. 13, Klara, meine Oma. Kind einer Zweckehe – verwöhntes Nesthäkchen und Sorgenkind. Mit sechs Jahren litt sie an einer schweren Augenkrankheit, weshalb sie monate- oder sogar jahrelang in einem dunklen Zimmer bleiben musste. Die Krankheit ließ sie nahezu erblinden, weshalb sie der Familie nicht im Haushalt helfen konnte. Beim Kochen vertauschte sie die Ofenklappen und schmiss die Kartoffeln zu den Kohlen. Als einziges leibliches und jüngstes Kind beider Eltern und mit zwölf Halbgeschwistern war sie etwas Besonderes und wurde von der ganzen Familie verwöhnt. Später, als junges und unbeobachtetes Mädchen von vielleicht 17 Jahren verliebte Klara sich in Edgar – einen charmanten jungen Mann. Es muss Ende der 1930er gewesen sein. Sie wurde schwanger, er verschwand als Soldat in den Wirren des 2. Weltkriegs und kam nie zu ihr zurück. Klara bekam einen Jungen – Edgar. Vielleicht überfordert, aber ganz bestimmt unglücklich verliebt wollte sie nur noch eins, den Vater ihres Kindes eifersüchtig machen, sollte er doch noch auftauchen. In ihrer Kindheit hatte sie gelernt, für sich zu sein – sie wollte auch als junge Frau selbständig und selbstbestimmt sein. Und sie traf sich mit weiteren jungen Männern, was ihren Geschwistern nicht verborgen blieb. Ihre Sehschwäche, ihre dadurch langsame und vorsichtige Art, die sie auf andere vielleicht dümmlich wirken ließ, ihr uneheliches Kind, ihre Umtriebigkeit, die ihrer Familie vielleicht peinlich war. Das alles nahmen ihre Geschwister zum Anlass, um einen Termin zur Zwangssterilisation zu erwirken. Keine Schwierigkeit in der NS-Zeit. Und übrigens auch heute noch unter bestimmten Umständen in 13 Ländern der EU erlaubt. Der Termin stand und sie waren schon auf dem Weg, aber Klara schaffte es irgendwie, diesem Schicksal zu entgehen. Es ist nicht überliefert, ob sie sich wehrte oder weinte, aber irgendwas brachte ihre Geschwister zur Vernunft und das Vorhaben wurde nicht umgesetzt.
Als der Krieg vorbei war und die Besatzungsmächte ihre Soldaten stationierten, lockten diese mit den eingangs genannten Fisimatenten. Auch Klara – und sie wurde wieder schwanger. Sie bekam eine wunderbare Tochter von einem schönen Franzosen mit Stupsnase. Als er zurück nach Frankreich durfte, wollte er Klara und die gemeinsame Tochter mitnehmen, aber er hatte keine Chance. Klara blieb in Deutschland, nun mit zwei Kindern, ohne deren Väter und weiterhin nicht in der Lage, in der Nachkriegszeit eine Familie zu versorgen. So kam ihre Tochter mit ca. zwei Jahren ins Kinderheim. Bis heute sind beide Väter nicht auffindbar.
Nach Ende des Krieges wurden die Karten neu gemischt. Millionen Menschen hatten ihre Heimat verloren. So auch Eugen. Ein Rumäne aus Bukowina, der viele Jahre in Arbeitslagern verbringen musste und nun – freiwillig oder unfreiwillig – in Deutschland blieb. Die deutsche Sprache brachte er sich selbst bei. Lange Zeit versuchte er, seine Mutter und seine Schwester zu finden. Vergeblich. Es ist unbekannt, ob sie überlebten oder ob sie auf der Flucht oder in einem Arbeitslager starben. Irgendwann traf Eugen auf Klara. Die beiden verliebten sich, oder zumindest reichte es für eine erneute Schwangerschaft und meine Großeltern drängten zur Hochzeit. Eugen nahm Edgar als seinen Sohn an und holte Klaras Tochter aus dem Heim zurück. Es folgten noch zwei Söhne und Anfang der 50er eine Tochter – meine Mutter. Eugen war ein strenger Vater. Er verwaltete die Ressourcen der Familie: das Geld, zu dem nur er Zugang hatte und die Lebensmittel, denn nur er bereitete das Essen zu. Die Kinder mussten in der Zwei-Zimmer-Wohnung bleiben und brav und still nebeneinander auf der Couch sitzen. Benahmen sie sich nicht so, wie er es sich vorstellte, wurde er jähzornig, schrie und schlug auch mal zu.
Meine Mutter verbrachte immer mehr Zeit auf der Straße. Sobald ihr Vater nach Hause kam, lief sie weg. Sie nahm in Kauf, dass er ihretwegen täglich tobte. Als junges Mädchen arbeitete sie auf Kartoffelackern, bekam fünf Mark pro Tag, wovon sie vier ihrem Vater geben musste. Doch als sie älter wurde, nahm sie einen Job an, bei dem sie Daten mittels Lochkarten in Computer eingab, die ganze Räume füllten. Die 60er waren das Jahrzehnt der Wirtschaftswunder, Rezession, erneutem Aufschwung, Protesten und Aufstand der jungen Generation gegenüber den „Alten“. Die Tugenden Fleiß, Unterordnung und Gehorsam wurden abgelöst durch Freiheitsliebe und Mitbestimmungsdenken. Anfang der 70er ging dieser Trend weiter – deutsche Soldaten durften lange Haare tragen, berufstätige Frauen durften nicht mehr mit „Fräulein“ angesprochen werden… Die Debatten um diese Entscheidungen erinnern sehr an heutige Gender-Debatten.
Etwa zu dieser Zeit traf meine Mutter meinen Vater. Lange Haare, Schlaghose, Schnäuzer. Fernfahrer. Eigentlich stand ihre Freundin auf ihn und sie selbst war überhaupt nicht interessiert. Aber er ließ nicht locker und eroberte sie. Mama war ungefähr in dem Alter, in dem ihre Mutter sich in den Vater ihres ersten Kindes verliebte. Aber auch jetzt noch, fast 40 Jahre später, war die Volljährigkeit erst mit dem 21. Geburtstag erreicht. Das sollte sich erst 1975 ändern. Meine Mutter musste also – aller Freiheitsliebe zum Trotz – jeden Abend zurück zu ihrem unterdrückenden Vater. Ein Schlupfloch gab es jedoch: Sollte ihr Vater einer Hochzeit zustimmen, würde sich die Vormundschaft auf ihren Ehemann übertragen. Mein Opa stimmte zu, blieb aber hart. Nach der Verlobungsfeier musste meine Mutter abends wieder nach Hause, erst am Tag der Hochzeit setzte mein Vater sich durch und nahm sie endlich für immer mit in das nun gemeinsame Leben. Doch der Start in dieses Leben sollte holprig werden:
Hatte meine Mutter vor ihrer Ehe noch ein eigenes Konto, war dies nun automatisch auf ihren Ehemann und Vormund überschrieben worden. Plötzlich stand da sein Name. Trotz aller Kämpfe um Freiheit und Gleichberechtigung, parallel zu den Anfängen der neuen Frauenbewegung rund um Alice Schwarzer, hatte das Patriarchat voll zugeschlagen. Vielen Frauen hatten solche Aktionen die Existenzgrundlage und ein großes Stück Selbstwertgefühl genommen. Meine Eltern versuchten gleichberechtigt zu leben, aber spätestens im Haushalt waren die Rollen klar und klassisch verteilt. Als meine Mutter das erste Mal nach der Hochzeit Gulasch kochen sollte – während mein Vater im Wohnzimmer Zeitung las – ließ sie das Fleisch anbrennen und brach weinend in der Küche zusammen. Ihr eigener Vater hatte doch nie jemanden an den Ofen gelassen, woher hätte sie wissen sollen, wie man kocht? Aber das ist gar nicht das Traurige an der Geschichte. Traurig ist, dass sie sich nicht getraut hat, meinem Vater davon zu erzählen. Als er zwei Stunden später nachsehen wollte, wo das Essen bleibt und in die verrauchte Küche trat, fand er dort meine noch immer heulende Mutter. Er nahm sie in den Arm, fragte völlig unverständlich, warum sie ihm das nie gesagt hatte und kochte einfach selbst. In den nächsten Jahren lernte sie das Kochen übrigens von meinem anderen Opa, ihrem Schwiegervater.
Vier Jahre nach der Hochzeit bekamen meine Eltern ihr erstes Kind, meinen großen Bruder. Meine Mutter hörte auf zu arbeiten und mein Vater ließ auf ihren Wunsch die Fernfahrerei sein, um öfter zu Hause sein zu können. Weitere sechs Jahre später kam ich auf die Welt, Anfang der 80er. Ein völlig verrücktes Jahrzehnt, zu dem ich keinerlei Bezug habe. Ich erinnere mich, dass meine Mutter stundenweise als Putzhilfe arbeitete und erst als ich älter war in Teilzeit einen miesen Arbeiterinnenjob in einer Großwäscherei annahm, der sie später durch Mobbing in die Depression trieb. Mein Vater arbeitete rund um die Uhr und war kaum zu Hause.
Ich bin mit diesem ganz typischen Rollenbild von Mann und Frau großgeworden. Doch meine eigene Kindheit soll hier und jetzt kein Thema sein.
Dieser Text endet hier. Er ist nur ein kleiner Auszug aus drei Mütter-Generationen und ihren ganz eigenen Hindernissen und Schicksalen. Ob sich diese transgenerationalen Traumata nachteilig oder positiv (Thema Resilienz) auf mein Leben auswirken, konnte ich für mich noch nicht klären.
Was weißt du über die Geschichte deiner Familie?